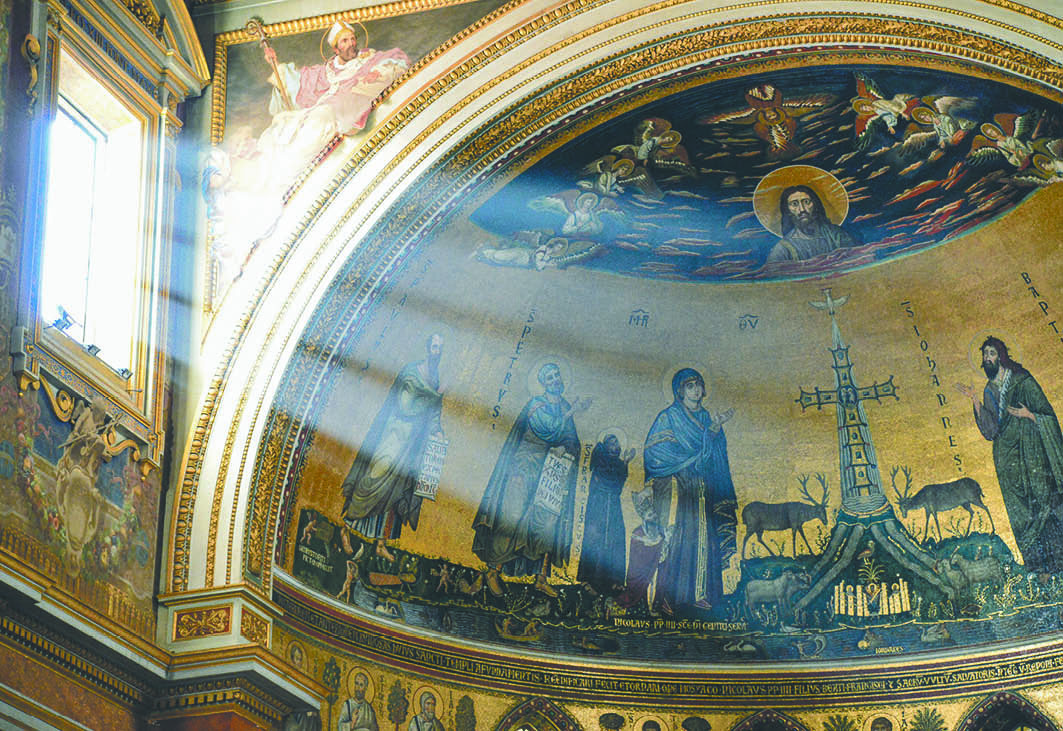Die Tempelreinigung steht im Johannesevangelium ziemlich am Anfang, gleich nach dem ersten Wunder Jesu bei der Hochzeit von Kana. Im Unterschied zu den anderen Evangelien war Jesus nach Johannes mehrmals in Jerusalem, allein dreimal am Paschafest. Beim ersten davon betritt Jesus gleich den Tempel und wirft die Geldwechsler und Tempelhändler samt Opfertieren aus dem „Haus seines Vaters“. Jesus – der Inbegriff der Gewaltlosigkeit – wird hier offenbar selbst gewalttätig im „Eifer für den Herrn“. Für Jesusgegner aller Zeiten ein willkommenes Argument, um die Glaubwürdigkeit Jesu als Pazifist und somit die Gewaltlosigkeit aller Religion(en) in Zweifel zu ziehen. Jesusfreunde aller Zeiten verweisen dagegen darauf, dass der Heiland ja keine Menschen geschlagen, sondern nur Geld ausgeschüttet und Tische umgestoßen habe. Zudem habe Jesus – insgesamt betrachtet – durch die Hingabe seines eigenen Lebens alle blutigen Opfer(-Tiere) für immer obsolet und das schon mit der Tempelreinigung deutlich gemacht. Dennoch: Die Szene bleibt ambivalent in ihren Interpretationsmöglichkeiten. Warum überhaupt bauten Menschen aller Zeiten riesige Tempel und Gotteshäuser? Um Gott zu ehren – in Stein und Mörtel? Weil angesichts der Größe Gottes den größenwahnsinnigen Menschen nichts Besseres einfiel? Um sich selbst Zeichen und Andenken zu setzen? Auch Gotteshäuser in all ihrer Schönheit, aber wegen der dafür oft genug in Kauf genommenen Entbehrungen, bleiben ambivalent.
Jesus selbst gibt nach Johannes den entscheidenden Hinweis: Er meint den Tempel seines Leibes, nicht den aus Stein, der niedergerissen und wieder aufgerichtet werden kann. Der Weg zu Gott führt immer über Jesus – und manchmal gerade nicht durch ein Gotteshaus.
Dietmar Steinmair ist Geschäftsführer des Katholischen Bildungswerks Vorarlberg und Teamleiter im Pastoralamt der Diözese Feldkirch. sonntag@koopredaktion.at